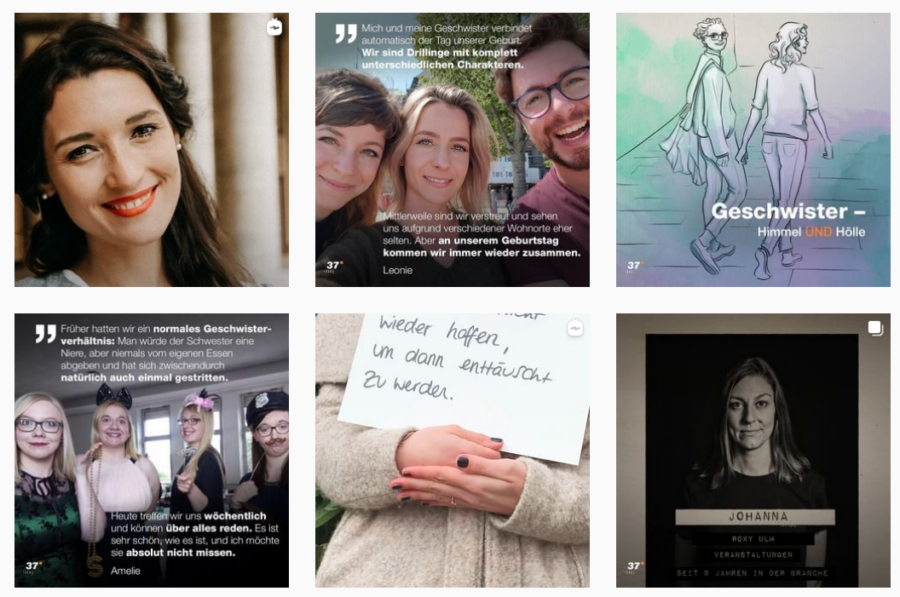Sag‘ mir, wo die Geschwister sind …
Eine Frage an Professionelle, die Herkunftsfamilie und die Geschwister selbst
Frage an die Geschwister
In Deutschland leben nach eigenen Berechnungen etwa zwei Millionen Geschwister von psychisch Erkrankten vom Kindes- bis zum Greisenalter, von denen viele erheblich belastet, etliche sogar einer Risikogruppe zuzurechnen sind – warum meldeten sich Einzelne von ihnen erst vor wenigen Jahren öffentlich zu Wort? Im englischsprachigen Ausland gibt es schon seit den 1990er-Jahren Forschungen und Hilfsangebote, beides zumeist von Geschwistern (mit-)initiiert.
Die Antwort geben die Geschwister selbst. Bevor sie in Gruppen aufeinandertrafen, ging jede und jeder davon aus, das eigene Erleben sei einmalig und sie müssten damit allein fertigwerden. Sowohl in den üblichen Angehörigengruppen als auch in therapeutischen Settings empfanden sie sich als ‚nur eine Schwester, nur ein Bruder‘. Dennoch bildeten einige wenige von ihnen separate Geschwistergruppen wie in Berlin und München; das GeschwisterNetzwerk regt weitere Gruppen an, die bereits initiierten findet man auf der Homepage.
Die individuelle Bereitschaft von Geschwistern, sich selbst aktiv zu verbergen ist in der familiären Dynamik begründet.
Frage an die Herkunftsfamilien
Auch in den eigenen Herkunftsfamilien werden viele der Geschwister unsichtbar. Geschwisterkinder kommen vor allem dann ins Spiel, wenn sich Eltern die beängstigende Frage stellen: Was wird, wenn wir nicht mehr sind? Ansonsten spielt sich für die Geschwister eine typische familiäre Rolle ein, die ihnen selbst und ihren Eltern vorgaukelt, sie seien die gesunden, starken und problemlosen Kinder, Jugendlichen und später auch Erwachsenen; sie sehen sich selbst z. B. als die große starke (kleine schwache) Schwester. Sie neigen dazu, ihre Bedürfnisse und ihre verwirrenden Gefühle vor sich selbst und der Familie zu verbergen, um nicht zum Leid der Familie beizutragen. Diese Rollendefinition wird von Eltern nur zu gern bestätigt, da sie sich mit den Fragen der Erkrankung und deren Begleitumständen voll und ganz ausgelastet, wenn nicht bereits überlastet sehen.
Die Frage nach dem ‚Später‘ treibt die Familienmitglieder bereits sehr bald nach Erkrankungsbeginn um, aber über viele Jahre hinweg wird darüber nicht miteinander gesprochen. Das bleibt nicht ohne Kosten. Viele Eltern machen sich später Vorwürfe, Geschwisterkinder übersehen zu haben und auf deren Bedürfnisse nicht eingegangen zu sein; für viele Geschwister wirkt das familiäre Schweigen wie ein Trauma, denn nicht nur ›die bange Frage‹ wird familiär exkommuniziert, sondern auch das sich ausbreitende Gefühlschaos mit vielfältigen Ambivalenzen sowie die interaktiven Dilemmata, mit denen sie die familiäre Dynamik konfrontiert. Tikva Natan (1981) hat dafür die prägnante Bezeichnung ‚conspiracy of silence‘ eingeführt (zitiert in Nir 2018).
Geschwister leiden massiv unter den stillen Erwartungen der Eltern, wobei sie einerseits die direkten und indirekten Ansprüche der Eltern gern im Interesse der eigenen Selbstentwicklung zurückweisen würden, andererseits der Schwester oder dem Bruder liebend gern zur Seite stehen würden und zugleich sehr wohl das Leid der Eltern schmerzlich mitempfinden. Und nun? Häufig wird, um mit den Dilemmata fertigzuwerden, ein Moratorium gewählt: das frühzeitige bedingte Verlassen der Herkunftsfamilie, um nicht vollständig mit ihr brechen zu müssen. Kinsella u. a. (1996) nannten es ‚constructive escape‘, in Abgrenzung zu ‚unhealthy escapes‘, wozu sie unumstößliche Kontaktabbrüche und Substanzmissbrauch zählen.
Frage an die professionellen Leser dieses Beitrags
Wo sind in Deutschland die vielen Geschwister, die im (Gemeinde-)psychiatrischen Feld aktiv sind, und wie bringen sie ihre speziellen Erfahrungen ein? Studien und informelle Anfragen bestätigen: Es müssen recht viele sein.
Eine Reihe von Autoren konnte belegen, wie die Erfahrung, als Schwester oder Bruder eines psychisch erkrankten Geschwisters aufzuwachsen, zu Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzen führt, die geradezu für soziale Berufe prädestinieren: Unabhängigkeit, Kreativität, Empathie, Resilienz, Selbstbehauptung (Kinsella u. a. 1996); Friedrich u. a. (1999) betonen Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Geduld; Barack u. a. (2005) fanden im Vergleich mit Kontrollen ohne diese Erfahrung eine höhere Sensitivität anderen gegenüber, stärkere Zielorientierung, erhöhte Kreativität, erhöhtes Durchsetzungsvermögen, größere Unabhängigkeit und ein höheres Selbstvertrauen.
Bei einem Teil der Geschwister resultieren die besonderen Herausforderungen langfristig in einem persönlichen Gewinn; bei anderen jedoch in einer defizitären Lebenssituation, für ca. 15 Prozent von ihnen sogar in psychischen Erkrankungen, zum Teil mit einer höheren Krankheitslast als die Kinder eines psychisch erkrankten Elternteils (Cheng u. a. 2018; Popovic u. a. 2018).
Die drei Aufmerksamkeitsdefizite (Forschung, soziale und medizinische Praxis, Herkunftsfamilie) verstärken die ohnehin prekäre Lebenslage der Geschwister. Das GeschwisterNetzwerk wurde im Jahr 2017 auch deshalb ins Leben gerufen, um dies in informiert-aktive Aufmerksamkeit zu verwandeln. Außerdem finden Geschwister in einem Forum des Netzwerks Möglichkeiten für einen leicht zugänglichen Austausch.
Das Alter der Erstkonfrontation mit der Erkrankung und das Geschlecht machen einen Unterschied
Der Schwerpunkt der Erfahrungen des GeschwisterNetzwerks, aber auch der Literatur liegt bei erwachsenen Geschwistern. Die spärlichen für Geschwister im Kindesalter vorliegenden Daten verweisen vornehmlich auf die ungleich dramatischeren Belastungen dieser Geschwisterkinder (Barnett u. a. 2012).
Summer schreibt im Forum des GeschwisterNetzwerks: „Bei meiner Schwester (50 Jahre alt) wurde vor gut 30 Jahren eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Im Rückblick hörte damit meine durchaus glückliche Kindheit auf. (…) Als damals 11-jährige habe ich nicht ansatzweise verstanden, was da passiert.“ Und sie fährt fort: „Jetzt, 20 Jahre später (…) waren plötzlich alle Gefühle wieder da: Angst, Scham, Überforderung, Wut, Hilflosigkeit.“ Dies ist ein typisches Zitat bei der Rückschau auf den Erkrankungsbeginn des Geschwisters; es verdeutlicht zudem die ‚Langzeitwirkungen‘, die in den Geschwistergruppen gemeinsam bearbeitet werden.
Je älter die Geschwister sind, wenn die Erkrankung in die Familie einzieht, desto weiter ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung fortgeschritten, und desto weniger einschneidend wirken sich die Eruptionen aus. Darüber hinaus gibt es deutliche Hinweise auf ein stärkeres Belastungserleben von Schwestern, begründet in deren höherer Bereitschaft zur Sorge, was den Konflikt zwischen familiärer Einbindung und Individuation verschärft.
Wird man als junger Erwachsener erstmals mit der psychischen Erkrankung des Geschwisters konfrontiert, werden nicht selten als Bewältigungsversuch Engagements gewählt, deren Sinnhaftigkeit infrage gestellt werden muss. Dazu gehören z. B. Bemühungen, Krankenhausaufenthalte zu vereiteln oder Fantasien, durch Zuwendung allein die Krankheit zu heilen oder die Auffassung, die Eltern müssten sich anders verhalten, dann wäre alles wieder gut. Solche Fantasien hatte auch der Autor dieses Textes zu Beginn der Erkrankung seines Bruders Ingo, bis der ihn die Realitäten einer psychischen Erkrankung lehrte.
Man darf darin den Versuch erkennen, sich in der unverstandenen und nicht beeinflussbaren Situation der Ersterkrankung wenigstens in der Fantasie Handlungsfähigkeit zu suggerieren. Der Autor fand seine Handlungsfähigkeit erst viele Jahre später durch das Engagement für gemeindepsychiatrische Versorgungsstrukturen zurück, die sein Bruder allerdings – da zu paternalistisch – für sich selbst ablehnte.
Bei einigen Geschwistern sind ähnliche Verarbeitungsversuche zu erkennen, wenn z. B. ein Bruder vehement für Psychotherapie bei psychischen Erkrankungen kämpft, gegen die aus seiner Sicht einseitige Behandlung mit Medikamenten. Oder wenn mehrere Schwestern für sich als Lebensziel den Kampf für eine ‚gute Versorgung‘ erkennen und dafür bisherige Berufskarrieren aufgeben (siehe u. a. Hauschild 2019).
Titelmann (1991) würde das eine quasi maniforme Verarbeitung der eigenen Hilflosigkeit nennen, wobei sich das Versorgungssystem in seiner grundsätzlichen Unvollkommenheit vorzüglich dafür eignet. Qua Externalisierung könne, würde Titelmann sagen, den Mängeln des Versorgungssystems oder Personen wie den Eltern die eigene Hilflosigkeit und das eigene Schulderleben übertragen werden.
Schwester oder Bruder eines psychisch erkrankten Menschen sein – Herausforderungen, Belastungen und Chancen
Erkrankt ein Familienmitglied, werden alle Routinen und Rollen durcheinandergerüttelt, nichts ist mehr so wie vorher; dennoch wird der Wunsch, alles möge wieder so werden wie früher, sehr lange aufrechterhalten. Schon frühe Studien haben hervorgehoben: Am stärksten ist die Rolle der Geschwister innerhalb und außerhalb der Familie betroffen (Lively u. a. 1995; Schrank u. a. 2007, S. 223), neben dem nur schwer zu händelnden Gefühlsmix, den Folgen für die Bindung zu der erkrankten Schwester bzw. dem Bruder sowie der familiären Dynamik, die als interaktive Dilemmata für die Geschwister sowohl als Ursache wie auch als Wirkung imponieren.
Geschwisterliche Bindungen – eine Bindungsreserve
Geschwisterbeziehungen gehören zu den intensivsten im Leben eines Menschen. Nach Schneewind stellen Geschwisterbeziehungen „… einen Beziehungstypus ganz besonderer Art dar (…), da sie in der Regel die am längsten währende unaufkündbare und annähernd egalitäre menschliche Beziehung ist, die auf einer gemeinsamen Vergangenheit beruht“ (Schneewind 2000, S. 160).
Frick (2015) betont das ‚unauflösbare Band‘ aufgrund gemeinsamer Herkunft und Entwicklungserfahrung. Bank und Kahn (1989, S. 8) halten die Geschwisterbeziehungen für die dauerhaftesten und einflussreichsten Beziehungen überhaupt, die selbst nach einem Kontaktabbruch fortbestehen.
Genser (2010) hat Geschwister in einer psychiatrischen Klinik beobachtet. Er sah einen „geschwisterlichen Umgang von einer spezifischen Nähe bei gleichzeitig unbedingter wechselseitiger Anerkennung der eigenen Persönlichkeit“ (ebd., S. 53). Geschwister stehen deutlich seltener in der Gefahr wie Eltern, von denen einige einer Studie zufolge in der Betreuung ihres Kindes ihre ‚Lebensmission‘ erkennen (Schwartz u. a. 2002).
Die besondere Beziehung generiert eine geschwisterliche Bindungsreserve. In turbulenten Zeiten, in denen die Eltern keinen Zugang zum Erkrankten mehr finden und ggf. auch die Behandler an eine Grenze stoßen, können Geschwister in Kontakt bleiben. Aus familientherapeutischer Sicht sagt Thomas Bock: „Geschwister katalysieren heraus, was krankheitsspezifisch ist und welche Reibungen in der Familie vom Generationenkonflikt herrühren.“ (Bock zitiert in Hauschild 2019, S. 187) Die positiven Geschwisterbeziehungen stellen für das psychisch erkrankte Geschwister eine eindeutig feststellbare Ressource bzw. ein ‚healing potential‘ dar (siehe Bojanowski 2016; die Altersspanne der Probanden reichte vom 4. bis zum 18. Lebensjahr).
Gefühle und Ambivalenzen
Auf dem Hintergrund der geschwisterlichen Bindungsqualität löst die Erkrankung eine in sich widersprüchliche Gefühlskaskade mit tief greifenden Ambivalenzen aus. Stålberg u. a. (2004, S. 448 f.) fanden ebenso wie Barak u. a. (2005, S. 237) Gefühle von Liebe und Kummer, Wut und Zorn (Neid eingeschlossen) sowie Schuld und Scham. Sin u. a. (2012, S. 55) zählen in ihrer Befragung von Geschwistern Ersterkrankter folgende Gefühle auf: Verzweiflung, Distanzierung, Verlegenheit, Angst (um sich, um ihr Geschwister, um ihre Familie), Schuld, Hoffnungslosigkeit, Verlust und Kummer, Ärger, Schock und Trauer. Titelmann (1991, S. 80) spricht von einer ‚too-close-and-too-distant experience‘, der Erfahrung zugleich zu nahe und zu fern zu sein.
Neben die genannten Gefühle treten ängstlich besetzte Befürchtungen, von denen die Angst, selbst psychisch zu erkranken, besonders einschneidend erlebt wird. Diese Angst wird von den landläufigen Debatten um den genetischen Anteil an psychischen Erkrankungen befeuert und führt bei einigen Geschwistern bis zur Aufgabe eines Kinderwunsches. Dabei wird der ‚genetische Anteil‘ überschätzt. Selbst renommierte Genetiker bezweifeln, dass die erhöhte Krankheitslast bei Geschwistern allein den Genen zuzumessen sei. Im Gegenteil: Die von Ambivalenzen und interaktiven Dilemmata geprägte Belastungssituation spielt eine herausragende Rolle bei der Krankheitslast, was sowohl von Fallgeschichten als auch epigenetischen Studien untermauert wird. (Diese Thematik ist für Geschwister von so großer Bedeutung, dass Argumente und empirische Belege in der in Kürze erscheinenden Monografie desselben Autors unter Mitarbeit von Leonore Julius ausgeführt werden; der hier vorliegende Beitrag greift einige Aspekte der Monografie auf; Peukert 2020.)
Gefühlskaskaden und Herausforderungen formen sich zu einem komplexen Dilemma
Das Dilemma resultiert aus dem miterlebten Leid des geliebten Menschen, der immer wieder aufkeimenden Wut über sein unangemessenes Verhalten, seiner Absorption der elterlichen Aufmerksamkeit und Fürsorge, der Erwartung der Eltern, sich an der Sorge zu beteiligen, dem gleichzeitig starken Wunsch zu helfen – gepaart mit der Erfahrung, keinen durchgreifenden Erfolg der Bemühungen zu sehen und der ‚geschwistertypischen‘ Solidaritätsschuld: dem Gefühl, nie ausreichend für das Geschwister zur Verfügung zu stehen – und dies alles gerahmt von der alterstypischen Aufgabe, eine mit sich identische handlungsfähige Person zu werden, u. a. die Ablösung vom Elternhaus, die Anbahnung einer Beziehung mit einer längerfristigen gemeinsamen Perspektive, die Stabilisierung der beruflichen Orientierung.
Vielen Geschwistern gelingt es im Austausch mit Peers, ihre emotionalen Ambivalenzen zu erkennen und sich von empfundenen Verpflichtungen und Schuldgefühlen zu befreien, um sich dann bewusst und eigenverantwortlich für Art und Umfang ihrer Beteiligung an Unterstützungsmaßnahmen zu entscheiden. „(Ich habe es geschafft,) sie alle erst mal aus mir herauszuschmeißen. Es gab sogar eine Phase, wo ich gedacht habe, ich hätte sie dauerhaft rausgeschmissen – aber das war natürlich ein Irrtum. Aber es war wichtig, buchstäblich in mir Platz für mich zu schaffen, (…) um zu mir zu kommen.“ (Eine Schwester aus der Berliner Geschwistergruppe).
Für viele Autoren (u. a. Schmid u. a. 2009) ist das der tagtägliche Lebenskonflikt der Geschwister: sich von der erkrankten Schwester bzw. dem Bruder sowie den Eltern um der eigenen Individuation willen zu lösen – ohne dafür mit schweren Schuldgefühlen bezahlen zu müssen. Daher sind die im Folgenden aufgezählten Bewältigungsmuster zumeist höchst labile, nur vorübergehend funktionale Weisen, in den Widersprüchen psychisch zu überleben. Es sei daran erinnert: Bei vielen Geschwistern führt dies zu einem deutlichen Gewinn für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, für andere in eine prekäre Lebenssituation.
Schuldgefühle und Bewältigungsstrategien
Aus den Interviews und Protokollen sowie der internationalen Literatur konnten sechs probate Strategien von Geschwistern herausgelesen werden.
- Die psychisch-mentale Strategie (die Bindungen zum Geschwister und den Eltern möglichst weit herunterschrauben)
- Die kognitive Vermeidung qua Ablenkung z. B. durch Arbeit oder Hobbys
- Der Erkrankung des Geschwisters einen Sinn für das eigene Leben geben
- Die objektivierende Professionalisierung
- Die systemische Strategie: das partielle familiäre Schweigen
- Die körperlich-physikalische Strategie: Moratorium bzw. konstruktive Flucht
Die ersten beiden Strategien verstehen sich von selbst.
In den Interviews und Studien finden sich unterschiedliche Wege, der Erkrankung einen Sinn für das eigene Leben zu geben. Dazu zählen die Bemühungen um das öffentliche Verständnis für psychisch erkrankte Menschen, und auch die Übernahme von Hilfeverantwortung dem erkrankten Geschwister gegenüber kann als Sinngebung re-interpretiert werden. Allerdings stehen dem Kosten gegenüber. Nach den Studienergebnissen von Jansen u. a. (2015) sowie Taylor u. a. (2008) korreliert die Übernahme von Hilferollen durch die Geschwister mit geringerer psychosozialer Funktionalität, höherer Belastung, ungenügendem Kümmern um die eigene Selbstsorge und verringerter Fähigkeit, Erwartungen an die Rolle als Erwachsener zu erfüllen. Auf der anderen Seite dürfen diese Geschwister mit einer erhöhten Aufmerksamkeit seitens der Eltern rechnen.
Nicht selten ist die Sinngebungsstrategie mit der ›objektivierenden Professionalisierung‹ verbunden, nämlich mit einer zunehmend professionelleren Beschäftigung mit Fragen psychischer Erkrankung bis hin zu Versorgungsfragen, was nicht selten zu einem Berufsleben im psychiatrischen (Um-)Feld führt. Mit einem (ggf. auch nur quasi-)professionellen Blick auf das eigene Erleben wird es ent-subjektiviert, ein intellektueller Abstand wird hergestellt, indem das Erleben nach außen gekehrt und dort einer professionell-distanzierten Betrachtung zugänglich wird. Dem Hilfeimpuls kann widerspruchsfrei gefolgt werden, und lt. Lively u. a. (1995) werden damit zugleich die Gefühle von Inkompetenz und Schuld kompensiert.
Dies gilt uneingeschränkt für den Autor dieses Textes; selbst den Suizid meines Bruders habe ich als Lehre für mich uminterpretiert. „… sein Suizid hat mich Demut gelehrt, verbunden mit der Einsicht, schwere Schicksalsschläge auch mal als das hinzunehmen, was sie sein können: Schicksal, das sich auch mit bestem Wollen und Handeln nicht ändern lässt“ (Peukert 2008).
Das partielle familiäre Schweigen wird als systemisch charakterisiert und es ist dysfunktional-funktional, da – wie oben ausgeführt – alle Familienmitglieder in aktiver Passivität an der Aufrechterhaltung beteiligt sind. Sie sind sich einig darin, ‚keine schlafenden Hunde zu wecken‘ und gehen vorsichtig miteinander um; wechselseitige Erwartungen, Zorn und Wut (aufgrund nicht erfüllter Erwartungen bzw. Wünsche) werden unterdrückt, was später zu Schuldgefühlen und Selbstzweifeln führen kann. Die ‚große starke (kleine schwache) Schwester‘ ist in diesem Umfeld die gängige Geschwisterrolle, die sich in der Familie einspielt: das nach außen starke und problemlose Kind, das sich selbst als klein und schwach wahrnimmt, und sich so vor Dritten und sich selbst verbirgt.
Das Moratorium ist die Strategie, durch ‚physikalische Distanzierung‘ aus den belastenden familiären Interaktionsbeziehungen Raum für die eigene Persönlichkeitsentwicklung herzustellen, und zugleich das familiäre Band aufrechtzuerhalten. Doch das Moratorium hat eine nur begrenzte Schutzwirkung. Immer wieder werden das erkrankte Geschwister oder die Eltern drängend präsent, nicht nur in Krisensituationen. Auch im Moratorium müssen sich die Geschwister immer wieder sagen: „Ich habe ein Recht auf ein eigenes Leben!“ – und sofort schleicht sich Zweifel ein.
Primäres Ziel und verborgene Falle professionellen Helfens
Alle Strategien enthalten das Moment der Distanzierung – von den bedrängenden Erfahrungen, von dem erkrankten Geschwister und/oder der familiären Dynamik. Die Distanzierungen führen nur zum Schein zu einer Reduktion der Betroffenheit, was die unzureichende professionelle Wahrnehmung der Lebensrealität der Geschwister erklären kann.
Alle Bemühungen um Geschwister sollten darauf hinwirken, die natürlichen Geschwisterbeziehungen zu erhalten oder wiederherzustellen. Der ‚Wert‘ des Geschwisters für die erkrankte Schwester bzw. den Bruder, aber auch für die Eltern beruht auf der geschwisterlichen Bindungsreserve. Geschwister sollten sich nicht dazu verführen lassen, in die Rolle eines Kümmerers zu schlüpfen wie die Mütter oder in die Rolle eines Co-Therapeuten, wie es von Josef Bäuml, dem frühen und vehementen Verfechter der Psychoedukation sowie Initiator der Arbeitsgruppe ‚Psychoedukative Interventionen bei der Behandlung schizophrener Erkrankungen‘ (Bäuml 2007) und anderen Professionellen eine Zeit lang propagiert wurde. Ingo, der Bruder des Autors, sagte vor Jahren, als dieser in eine semiprofessionelle Rolle verfiel: „Ich brauche einen Bruder, keinen weiteren Behandler!“
Beginnt man als professioneller Helfer mit Geschwistern das Gespräch, werden diese voraussichtlich alle erlernten Schutz- und/oder Bewältigungsmuster aktivieren. Diese hatten es ihnen bisher möglich gemacht, die widerstreitenden Gefühle, Schuldgefühle eingeschlossen, und interaktiven Dilemmata halbwegs erträglich lebbar zu machen. Die meisten von ihnen haben gelernt, ‚ihr Innenleben‘ im sozialen Austausch nicht erscheinen zu lassen, so wie sie auch gelernt haben, die Erkrankung des Geschwisters aufgrund der damit gegebenen Stigmatisierungsmöglichkeit im alltäglichen Umgang zu verbergen. Zudem schränkt die scheinbare Reduktion der eigenen Betroffenheit deren Sichtbarkeit deutlich ein, was die Gefahr in sich birgt, selbst im professionell zugewandten Gespräch an ihnen vorbeizureden.
Literatur
Bach, C. (2019): Langfristige Auswirkungen der Belastungen von Geschwistern an Schizophrenien erkrankter Menschen In: Aktion Psychisch Kranke: Tagungsband 45. Bonn: APK, 126 – 133
Bäuml, J. (Hg.) (2007): Psychoedukation – bei schizophren Erkrankten. Konsenspapier der Arbeitsgruppe ‚Psychoedukative Interventionen bei der Behandlung schizophrener Erkrankungen‘. 2. erweiterte und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Schattauer
Bank, S.P.; Kahn, M.D. (1989): Geschwister-Bindung. Innovative Psychotherapie und Humanwissenschaften Bd. 44, Paderborn: Junfermann
Barak, D.; Solomon, Z. (2005): In the shadow of schizophrenia: A study of sibling’s perceptions. In: The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 42 (4), 234 – 241
Barnett, R.A.; Hunter, M. (2012): Adjustment of sibling of children with mental health problems: Behaviour, self-concept, quality of life and family functioning. In: Journal of Child and Family Studies 21(2), 262 – 272
Bojanowski, S. (2016): Geschwisterbeziehungen im Kontext psychischer Erkrankungen. Dissertation Universität Potsdam; darin enthalten: Bojanowski, S.; Nisslein, J.; Riestock, N.; Lehmkuhl, U.: Siblings relationships of children and adolescents with mental disorders – risk factor or resource? Manuskript, 89 – 102
Cheng, C. M.; Chang, W. H.; Chen, M. H.; Tsai, C. F.; u. a. (2018): Co-aggregation of major psychiatric disorders in individuals with first-degree relatives with schizophrenia: a nationwide population-based study. In: Molecular Psychiatry 23 (8), 1756 – 1763
Frick, J. (2015): Ich mag dich – du nervst mich. Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben. Bern: Hogrefe; 4. überarbeitete und ergänzte Auflage
Friedrich, R.M.; Lively, S.; Buckwalter, K.C. (1999): Well siblings living with schizophrenia. Impact of associated behaviors. In: Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 37(8), 11 – 19
Genser, B. (2010): Nachrichten aus einer psychiatrischen Klinik. Norderstedt: Books on Demand Verlag
Hauschild, J. (2019): Übersehene Geschwister. Das Leben als Bruder oder Schwester psychisch Erkrankter. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
Jansen, J. E.; Gleeson, J.; Cotton, S. (2015): Towards a better understanding of caregivers distress in early psychosis: A systematic review of the psychological factors involved. In: Clinical Psychological Review 35, 56 – 66
Kinsella, K. B.; Anderson, R. A.; Anderson, W. T. (1996): Coping skills, strengths, and needs as perceived by adult offspring and siblings of people with mental illness: A retrospective study. In: Psychiatric Rehabilitation Journal 20 (2), 24 – 32
Lively, S.; Friedrich, R.M.; Buckwalter, K.C. (1995): Siblings perception of schizophrenia: Impact on relationships, roles and health. In: Issues in Mental Health Nursing 16(3), 225 – 238
Natan, T. (1981): Second generation Holocaust survivors in psycho-social research. In: Dapim Leheker Tkufat Hashoa 2, 13 – 26
Nir, B. (2018): Transgenerational transmission of holocaust trauma and its expressions in literature. In: Genealogy 2 (4), 49
Peukert, R. (2008): Geschwister sind auch Angehörige – wie die anderen auch, aber doch anders. In: Binder, W.; Bender, W. (Hg.): Angehörigenarbeit und Trialog. Auf dem Weg zu einer Trialogischen Psychiatrie. Köln: Klaus Richter Verlag, 105 – 127
Peukert, R. (2017): Erlebte, gelebte, erlittene Verantwortung von Schwestern und Brüdern eines psychisch erkrankten Geschwisters. In: Aktion Psychisch Kranke; Weiß, P.; Heinz, A. (Hg.): Verantwortung übernehmen. Verlässliche Hilfen bei psychischen Erkrankungen. Tagungsband 43, Bonn: APK, 168 – 190
Peukert, R. (2020): Monographie: Wie geht es denn den Schwestern und Brüdern (Arbeitstitel); in Vorbereitung
Popovic, D.; Goldberg, S.; Fenchel, D.; Frenkel, O.; u. a. (2018): Risk of hospitalization for psychiatric disorders among siblings and parents of probands with psychotic or affective disorders: A population-based study. In: European Neuropsychopharmacology 28 (3), 436 – 443
Schmid, R.; Schielein, T.; Binder, H.; Hajak, G.; Spiessl, H. (2009): The forgotten caregivers: Siblings of schizophrenic patients. In: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 13 (4), 326 – 337
Schneewind, K.A., (Hg.) (2000): Familienpsychologie im Aufwind. Brückenschläge zwischen Forschung und Praxis. Göttingen: Hogrefe Verlag.
Schrank B.; Sibitz, I.; Schaffer, M.; Amering, M. (2007): Zu Unrecht vernachlässigt: Geschwister von Menschen mit schizophrenen Psychosen. In: Neuropsychiatrie 21 (3), 216 – 225
Schwartz, C.; Gidron, R. (2002): Parents of mentally ill adult children living at home: rewards of caregiving. In: Health and Social Work 27(2), 145 – 154
Sin, J.; Moone, N.; Harris, P.; Scully, E.; Wellman, N. (2012): Understanding the experiences and service needs of siblings of individuals with first-episode psychosis. A phenomenological study. In: Early Intervention in Psychiatry, 6(1), 53 – 59
Stålberg, G.; Ekerwald, H.; Hultman, C. M. (2004): At Issue: Siblings of patients with schizophrenia: sibling bond, coping patterns, and fear of possible schizophrenia heredity. In: Schizophrenia Bulletin 30 (2), 445 – 458
Taylor, J.L.; Greenberg, J.S.; Seltzer, M.M.; Floyd, F.J. (2008): Siblings of adults with mild intellectual deficits or mental illness: Differential life course outcomes. In: Journal of Family Psychology 22(6), 905 – 914
Titelman, D. (1991): Grief, guilt and identification in siblings of schizophrenic individuals. In: Bulletin of the Menninger Clinic 55 (1), 72 – 84